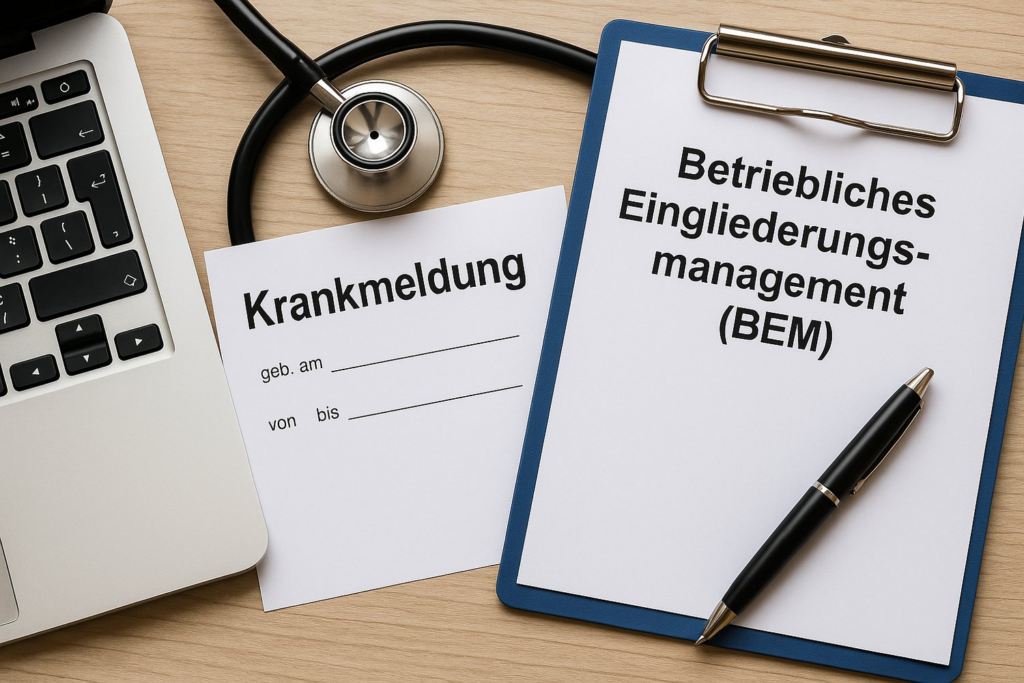Arbeitsunfähigkeit, BEM und Lohnfortzahlung: Rechte und Grenzen für Arbeitgeber
Immer wieder berichten Beschäftigte von Schreiben ihres Arbeitgebers, die im Krankheitsfall für Irritation sorgen. Dabei geht es häufig um Einladungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM), um Hinweise auf eine mögliche Beendigung der Entgeltfortzahlung oder um die Aufforderung, medizinische Diagnosen offenzulegen. Doch viele dieser Maßnahmen sind juristisch komplexer, als sie zunächst erscheinen. Im Folgenden gebe ich eine verständliche Übersicht über die wichtigsten Aspekte.
1. Das BEM ist eine Hilfestellung – kein Instrument zur Einschüchterung
Arbeitgeber sind verpflichtet, Beschäftigten ein BEM anzubieten, wenn diese innerhalb von zwölf Monaten mehr als sechs Wochen krankheitsbedingt gefehlt haben. Ziel ist es nicht, Druck auszuüben, sondern gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie die Arbeitsfähigkeit langfristig gesichert werden kann.
Problematisch wird es dann, wenn BEM-Einladungen mit strafenden Untertönen versehen sind – etwa mit dem Hinweis, dass bei weiteren Krankmeldungen arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen. Solche Formulierungen widersprechen dem Sinn des BEM und führen eher zu Misstrauen als zu Kooperation.
2. Entgeltfortzahlung bei Krankheit: Jeder Fall zählt individuell
Im Krankheitsfall haben Arbeitnehmer grundsätzlich Anspruch auf bis zu sechs Wochen Lohnfortzahlung pro Erkrankung. Tritt innerhalb kurzer Zeit eine weitere Krankschreibung auf, stellt sich die Frage: Gehören beide Fälle zusammen oder handelt es sich um eine neue Erkrankung?
Das Gesetz sieht vor: Nur wenn es sich um dieselbe Erkrankung handelt und keine Arbeitsaufnahme zwischen den beiden Krankheitsphasen erfolgte, wird der Zeitraum zusammengezählt. Andernfalls beginnt ein neuer Anspruchszeitraum.
Pauschale Hinweise, dass bei weiteren Krankmeldungen keine Lohnzahlung mehr erfolgt, sind deshalb rechtlich unzulässig. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, jeden Fall gesondert zu prüfen.
3. Kontakt zur Krankenkasse: Erlaubt, aber nicht grenzenlos
Arbeitgeber dürfen sich mit der Krankenkasse in Verbindung setzen, um Informationen zur Dauer und Einheitlichkeit der Arbeitsunfähigkeit einzuholen. Allerdings darf eine negative Rückmeldung der Krankenkasse nicht automatisch dazu führen, dass die Gehaltszahlung eingestellt wird. Auch hier muss der Arbeitgeber den Sachverhalt differenziert prüfen.
4. Medizinische Diagnosen sind Privatsache
Immer wieder kommt es vor, dass Arbeitnehmer gebeten werden, genaue Angaben zu ihrer Erkrankung zu machen oder medizinische Unterlagen vorzulegen. Dabei ist klar: Die Offenlegung einer Diagnose ist freiwillig. Gesundheitsdaten sind durch die Datenschutz-Grundverordnung besonders geschützt. Niemand ist verpflichtet, seine medizinischen Informationen unaufgefordert preiszugeben – auch nicht dem Arbeitgeber.
Fazit
Der Umgang mit krankheitsbedingten Fehlzeiten erfordert sowohl juristische Klarheit als auch menschliches Feingefühl. Arbeitgeber sollten gesetzliche Vorgaben nicht durch Druck oder unzulässige Forderungen umgehen. Beschäftigte wiederum sollten sich nicht verunsichern lassen – im Zweifelsfall ist rechtlicher Rat empfehlenswert.
Auf einen Blick:
-
BEM dient der Unterstützung, nicht der Drohung.
-
Lohnfortzahlung endet nicht automatisch nach sechs Wochen – entscheidend ist die individuelle Krankengeschichte.
-
Allgemeine Hinweise auf Zahlungseinstellungen sind rechtlich oft nicht haltbar.
-
Anfragen bei der Krankenkasse sind zulässig, ersetzen aber keine Einzelfallprüfung.
-
Die Offenlegung von Diagnosen ist freiwillig – der Datenschutz bleibt auch im Arbeitsverhältnis bestehen.