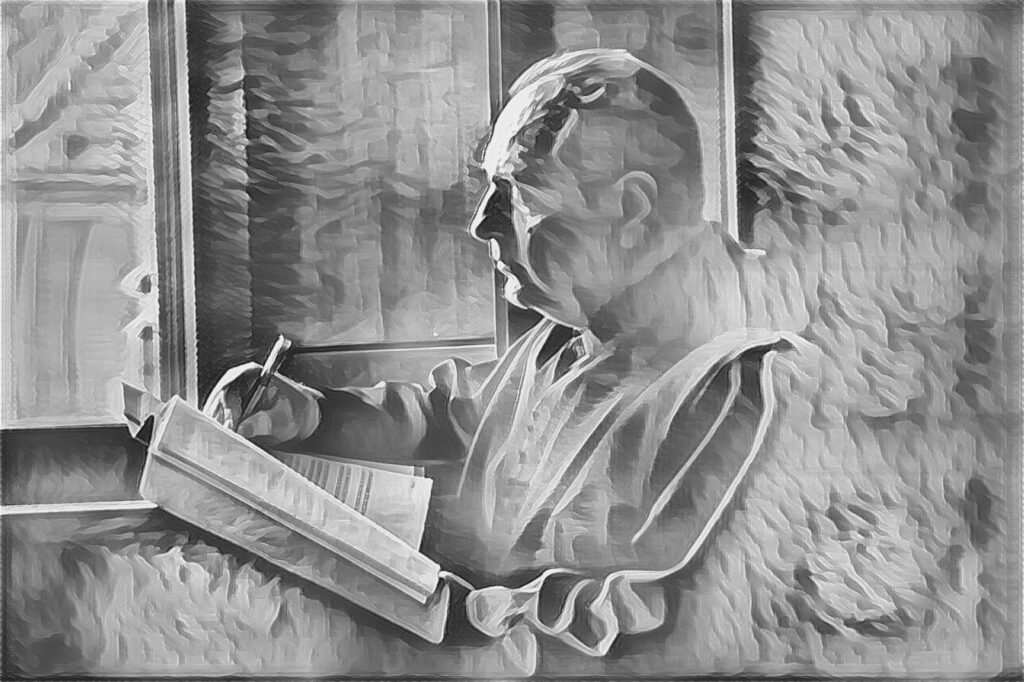Öffentlicher Appell zur Einrichtung unabhängiger Kontrollinstanzen für staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten und zur Errichtung einer europäischen Ombudsstelle für Justizopfer
Im Namen der anwaltlichen Praxis für Strafrecht und Antidiskriminierung sowie im Interesse zahlreicher Betroffener richtet sich dieser öffentliche Appell an das Europäische Parlament.
Ziel ist es, auf einen strukturellen rechtsstaatlichen Missstand aufmerksam zu machen, der nicht nur nationale Justizsysteme, sondern auch das Fundament der Europäischen Union berührt:
die faktische Straffreiheit
staatsanwaltschaftlicher und
richterlicher Amtsträger
bei Verstößen gegen das Recht,
die mangelnde externe Kontrolle dieser Organe
und die daraus resultierende Gefährdung
des Zugangs zum Recht für
Betroffene staatlicher Willkür.
Systemische Schutzmechanismen zugunsten der Justizakteure – ein rechtsstaatliches Defizit
In zahlreichen Mitgliedstaaten – insbesondere in Deutschland – unterliegen Staatsanwälte dem sog. „Weisungsrecht“ der Justizministerien (§ 146 GVG). Beschwerden über schwerwiegende Verfahrensverfehlungen wie Rechtsbeugung (§ 339 StGB), Verfolgung Unschuldiger (§ 344 StGB) oder Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB) werden in der Praxis selten verfolgt. Ermittlungen werden häufig durch dieselben Institutionen geführt, deren Angehörige beschuldigt werden – ein offenkundiger Interessenkonflikt.
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 117, 71) verlangt effektiven Rechtsschutz, der jedoch durch strukturelle Selbstkontrolle regelmäßig unterlaufen wird. Das Prinzip der „Gleichheit vor dem Gesetz“ (Art. 3 Abs. 1 GG) wird ausgehöhlt, wenn Angehörige der Justiz de facto nicht denselben strafrechtlichen Kontrollmechanismen unterliegen wie gewöhnliche Bürger.
Europarechtliche Anforderungen und
rechtsstaatliche Verpflichtungen
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Art. 47 GRCh) garantiert das Recht auf ein faires Verfahren und wirksame Beschwerdemöglichkeiten. Gleiches gilt für die Europäische Menschenrechtskonvention (Art. 6, 13 EMRK).
Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urt. v. 27.05.2019 – C-508/18 und C-82/19 PPU – OG und PI) stellt ausdrücklich klar, dass eine Staatsanwaltschaft, die politischer Weisung unterliegt, nicht als unabhängige Justizbehörde im Sinne des Unionsrechts anerkannt werden kann.
Fallbeispiele – symptomatisch für ein strukturelles Versagen
Hannover (Deutschland): Ein Staatsanwalt warnte mutmaßlich eine Drogenbande gegen Bestechungszahlungen und verhinderte eine großangelegte Razzia – ein gravierender Fall von Strafvereitelung im Amt.
Frankfurt am Main (Deutschland): Ein Oberstaatsanwalt vergab über Jahre überteuerte Gutachten an Firmen, an denen er selbst beteiligt war – und wurde erst nach erheblichem öffentlichen Druck strafrechtlich zur Verantwortung gezogen.
Weitere Verfahren gegen Justizbedienstete werden regelmäßig intern behandelt oder eingestellt, ohne unabhängige Prüfung – trotz nachgewiesener Anhaltspunkte für gravierende Verfahrensverstöße.
Forderungen zur Wiederherstellung
rechtsstaatlicher Kontrolle
Nationale unabhängige Kontrollinstitutionen
Jeder Mitgliedstaat der EU soll zur Einrichtung einer eigenständigen, außerhalb des Justizapparats stehenden Kontrollinstanz verpflichtet werden, die Beschwerden gegen Richter, Staatsanwälte und Justizbehörden objektiv und unabhängig prüft. Diese Instanz soll mit umfassenden Einsichts-, Ermittlungs- und Sanktionsbefugnissen ausgestattet sein und sich aus einem interdisziplinären Gremium aus Richterschaft, Anwaltschaft, Menschenrechtsinstitutionen und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammensetzen.
Errichtung einer europäischen Ombudsstelle für Justizopfer
Ergänzend wird die Schaffung einer zentralen europäischen Ombudsstelle für Justizopfer gefordert. Diese Institution soll:
a. Beschwerden über politische Strafverfolgung, strukturelle Rechtsbeugung, selektive Anklagen oder institutionellen Machtmissbrauch entgegennehmen und rechtlich bewerten,
b. interdisziplinäre Gutachten zur rechtlichen und verfassungsrechtlichen Bewertung der Einzelfälle erstellen,
c. den Zugang zu rechtlicher und psychologischer Unterstützung koordinieren – insbesondere für vulnerable Gruppen wie Geflüchtete, Minderheiten und politische Aktivisten,
d. jährliche öffentliche Berichte mit Empfehlungen an das Europäische Parlament und die Kommission vorlegen,
e. eine vertrauliche, digitale und mehrsprachige Beschwerdeplattform betreiben, auf die auch Personen aus restriktiven oder repressiven Mitgliedstaaten sicheren Zugang haben.
Diese Ombudsstelle soll institutionell unabhängig, parlamentarisch legitimiert und haushaltsrechtlich durch den EU-Haushalt abgesichert sein. Sie wäre ein entscheidender Schritt, um den Grundrechten auf Rechtsschutz, Gehör und Nichtdiskriminierung innerhalb der Union effektiv Geltung zu verschaffen.
EU-Register für Justizvergehen
Zur Sicherstellung von Transparenz und statistischer Auswertung soll ein öffentlich zugängliches Register über Justizvergehen und institutionelle Verfahrensergebnisse eingeführt werden – vergleichbar mit Antikorruptionsregistern. Ziel ist es, strukturelle Defizite sichtbar zu machen und politische wie juristische Reaktionen darauf zu ermöglichen.
Schutzvorschriften für Justiz-Whistleblower
Justizangehörige, die interne Missstände melden, sind in besonderer Weise gefährdet. Die Anwendung der EU-Whistleblower-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1937) auf den Justizbereich muss durch ergänzende Regelungen erweitert werden, insbesondere durch strafrechtliche Immunität bei wahrheitsgemäßer Offenlegung und Schutz vor dienstrechtlichen Sanktionen.
Justiz macht krank –
wenn sie nicht kontrolliert wird
Ein Aufschrei der vielen verfolgten Unschuldigen gegen staatsanwaltschaftliche Willkür und politische Strafverfolgung ist endlich ernst zu nehmen!