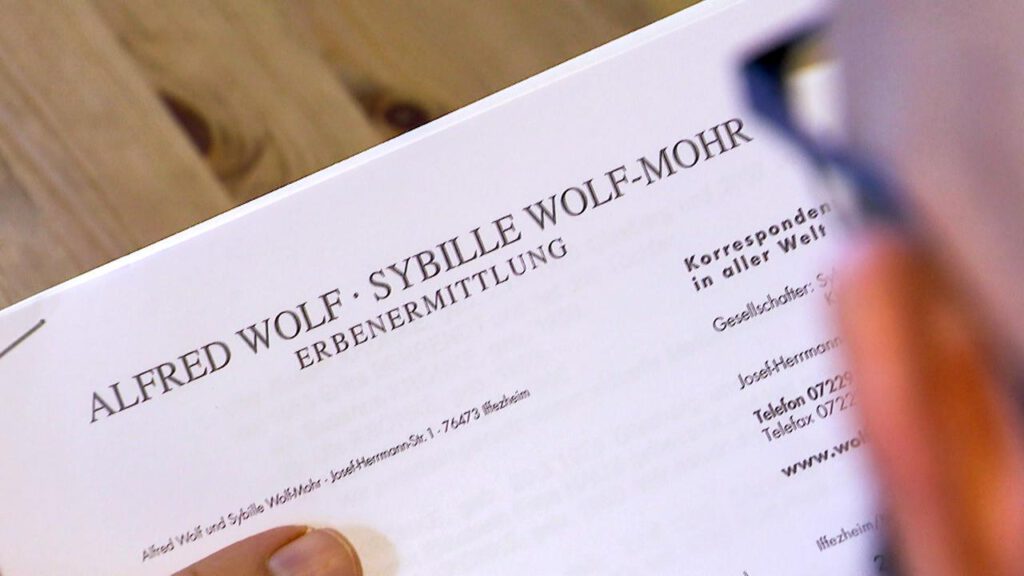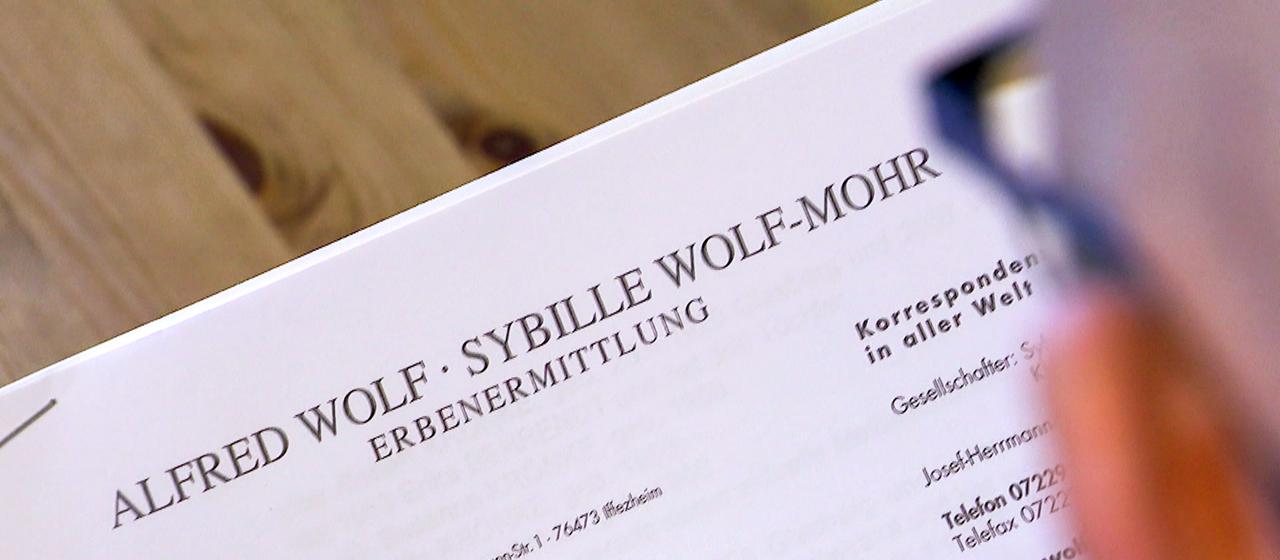
Wenn ein Mensch stirbt und keine Erben bekannt sind, beginnt die stille Detektivarbeit der Erbenermittler. Klingt nach Krimi, ist aber ein traditionsreiches Geschäftsfeld.
Der Gang zum Briefkasten – für Sören Damnitz aus dem rheinland-pfälzischen Winnweiler tägliche Routine. Als er vor drei Jahren von einer Erbenermittlung Post bekommt, ahnt er nicht, wie lange und intensiv ihn dieses Schreiben beschäftigen wird. Der erste Gedanke, der dem 42-Jährigen durch den Kopf schießt: „Da will mich jemand übers Ohr hauen!“
Sören Damnitz wurde vor drei Jahren von einer Erbenermittlung angeschrieben.
Trotzdem wirft er das Schreiben nicht gleich in den Müll, sondern liest es am Küchentisch wieder und wieder. Und das nicht nur, weil der Briefkopf der Erbenermittlung aus Baden-Baden so seriös aussieht. Es sind vielmehr die detaillierten Informationen in dem Schreiben, die ihn stutzig machen. Irgendwann versteht er: Eine weitläufige Verwandte seiner verstorbenen Oma aus Polen hat ihm wohl Geld hinterlassen.
Weil seine Familie tatsächlich Wurzeln im früheren Westpreußen hat, nimmt er die Sache irgendwann ernst. Auch weil in dem Brief Daten stehen, die stimmen und nicht im Internet zu finden sind: zum Beispiel der Mädchenname seiner Großmutter und ihr Geburtsjahr.
Hoffen auf das große Geld
Schmunzelnd erzählt der Pfälzer, dass spätestens an diesem Punkt die Hoffnung auf ein großes Erbe bei ihm aufgekommen sei: „Das Ganze erschien mir für eine plumpe Betrugsmasche dann doch zu aufwändig. Außerdem weiß ich, dass es in der polnischen Familie meines verstorbenen Vaters durchaus Geld gab.“ Sören Damnitz recherchiert zuerst im Internet über die Erbenermittlung, die ihn angeschrieben hat, nimmt schließlich telefonisch Kontakt mit ihr auf.
Erbenermittlung bedeutet Recherche in Familiengeschichten.
Ein freundlicher Mitarbeiter erklärt ihm in groben Zügen, worum es geht. Dass die verwitwete Erblasserin kinderlos gewesen sei und keine direkten Verwandten mehr lebten. Den Namen und letzten Wohnort der Verstorbenen bekommt der 42-Jährige erst mal nicht: „Der Erbenermittler sagt, dann könnte ich mich ja theoretisch beim zuständigen Gericht melden und das Erbe selbst antreten. Und dann würde sich seine ganze Recherchearbeit für ihn nicht auszahlen“, sagt Damnitz.
Arbeiten auf eigenes Risiko
Das hat etwas mit der Art der Bezahlung zu tun. Erbenermittler verlangen für ihre Arbeit normalerweise bis zu dreißig Prozent des Erbes. Müssen sie im Ausland recherchieren, auch mehr. Dazu kommt noch die Mehrwertsteuer. Beatrice Eisenschmidt vom Verband Deutscher Erbenermittler (VDEE) erklärt die Höhe des Honorars mit der oft aufwändigen, langwierigen und nicht selten erfolglosen Suche nach Erben: „Letztlich sind fast alle Fälle, die bei uns Erbenermittlern landen, knifflig.“
Erbenermittler kommen dann zum Einsatz, wenn Gerichte mit einem Nachlass nicht weiterkommen.
Denn: Erbenermittler werden meist dann eingeschaltet, wenn Nachlassgerichte selbst an ihre Grenzen kommen – etwa, weil es weder direkte Nachkommen noch Testament gibt. Nicht selten könnten trotz langwieriger Recherche auch keine Erben gefunden werden, betont Eisenschmidt, etwa weil – wie beispielsweise häufig in Polen – Unterlagen kriegsbedingt zerstört sind.
In solchen Fällen verdienen Erbenermittler keinen Cent – unabhängig davon, wie viel Aufwand und Geld sie selbst in den Fall bereits investiert haben. „Wir arbeiten immer auf eigenes Risiko“, betont Eisenschmidt. Deshalb würden Erbenermittler auch nur Aufträge annehmen, wenn zu vererbendes Vermögen vorhanden sei – und nicht ein Berg Schulden. Bezahlen müssten die Erben erst, nachdem sie das Erbe erhalten haben. Seriöse Erbenermittler würden niemals Vorkasse verlangen, sagt Eisenschmidt.
Gefragte Branche, vielfältige Detektivarbeit
Professionelle Erbenermittlung gibt es in Deutschland bereits seit dem 19. Jahrhundert. Eine Hochphase erlebte die Branche nach dem Zweiten Weltkrieg. Flucht und Vertreibung haben häufig schwierige Erbfälle als Folge – genauso wie zerrüttete Familienverhältnisse und eine zunehmend anonyme Gesellschaft.
Erbenermittler ist kein geschützter Beruf, das heißt, prinzipiell darf sich jeder und jede so bezeichnen. Nach Auskunft VDEE seien in der Branche aber vor allem Juristen, Historiker, Detektive, aber auch Journalisten tätig.
Zum einen brauche man juristisches Wissen, zum anderen müsse man gut recherchieren können – beispielsweise in Archiven und Kirchenbüchern, aber auch in der Nachbarschaft von Verstorbenen. Nicht selten führten viele kleine Puzzleteile und Informationen letztlich dazu, auf die Spur der Erben zu kommen. Manchmal kommen dabei auch gut gehütete Familiengeheimnisse wie zum Beispiel uneheliche Kinder ans Licht.
Auf den Spuren der Verwandtschaft
Zurück zu Sören Damnitz aus Winnweiler. Auch nach drei Jahren weiß der 42-Jährige noch nicht, wann er sein Erbe bekommt und wie hoch es sein wird. Nur so viel habe ihm der Erbermittler schon verraten, sagt der Pfälzer lachend: „Reich werde ich nicht, dazu seien zu viele Nachkommen im Spiel.“
Sören Damnitz will mit dem Erbe auf Spurensuche gehen.
Enttäuscht ist er deswegen nicht: „Letztlich bekomme ich wohl einige Hundert Euro ohne großen Aufwand. Das ist doch auch nicht schlecht“, sagt Damnitz. Das Geld will er für eine Reise nach Polen nutzen, die Orte besuchen, wo ein Teil seiner Familie ursprünglich herkommt. Eine solche Reise schwebt dem Pfälzer schon lange vor.